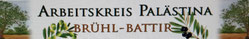Reihenfolge der Berichte umgekehrt-chronologisch
|
Rudolf Rogg:
Siedlergewalt, Vertreibung und schleichende Annexion im Westjordanland
|

Wer für eine der oben genannten Organisationen im besetzten Westjordanland unterwegs ist, hat zwei Aufträge: Er oder sie muss – erstens – die Lage vor Ort genau beobachten und dokumentieren, um dann – zweitens – in Deutschland darüber informieren.
Genau das tut Rudolf Rogg seit vielen Jahren. Zuletzt war er im Oktober 2024 in der Region; sein Bericht beruht also auf langjähriger Erfahrung und ist gleichzeitig sehr aktuell.
Die Beobachtungen, von denen er – gestützt auf viele eigene Fotos – berichtete, sind erschütternd.

Zunächst erinnerte er mit Hilfe von Landkarten an die Entwicklung der Aufteilung des gesamten Landes – also Israel plus Westjordanland – zwischen Israelis und Palästinensern. Die letzte Karte zeigte die drei Zonen, in die das Westjordanland seit den Osloverträgen (Oslo II: 1995) eingeteilt ist. Man kann sich nicht oft genug bewusstmachen, dass die Palästinenser in 60% des Landes, das nach diesen Verträgen einmal ihr eigener Staat werden sollte, bis heute nichts zu sagen haben.
Mit detailliertem Kartenmaterial ordnete Rogg sodann die drei Familien, deren Schicksal er im Anschluss genauer schilderte, geographisch ein. Zwei der Familie leben in Masafer Yatta, einem Gemeindeverband von ca. 20 palästinensischen Dörfern in den South-Hebron-Hills, im südlichen Teil der Westbank. Das ist die Region, in der auch der inzwischen vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilm No Other Land gedreht wurde. Die dritte Familie lebt in der Nähe der Stadt Nablus, die weiter im Norden der Westbank liegt.
Das Schicksal der drei Familien steht stellvertretend für viele palästinensische Bauern in der Westbank. Der gemeinsame Nenner ist:

Einschüchterung, Drangsalierung und Vertreibung durch jüdische Siedler, die von der israelischen Besatzungsarmee unterstützt werden.
Die Vertreibungen verstoßen eindeutig gegen die Vierte Genfer Konvention.
Eine Konstante bei diesen Aktionen ist die Zerstörung von Häusern, Ställen und Schuppen. Viele palästinensische Familien haben das bereits mehrfach erlebt. Weitere Aktionen der jüdischen Siedler: Sie schädigen oder vernichten die Felder, indem sie beispielsweise die keimende Saat mit Traktoren plattfahren oder ihre eigenen Schafe kurz vor der Getreideernte in ein Feld treiben; Olivenbauern werden bei der Ernte ihrer Früchte massiv behindert; oft werden auch uralte Olivenbäume mit Baggern ausgerissen oder ganze Olivenhaine abgefackelt; auch vor der Tötung von Nutztieren schrecken die Siedler nicht zurück, was einige Fotos von verendeten Jungtieren – Ziegen, Schafen, Eseln – auf beklemmende Weise dokumentieren. Sinnlose Vernichtung, nur um zu zeigen, wer das Sagen hat; und letztlich mit dem Ziel, den palästinensischen Bewohnern das Leben so unerträglich zu machen, dass sie ihre angestammte Heimat „freiwillig“ verlassen.
In den South-Hebron-Hills ist die übliche Begründung für die Vertreibungen, dass das Gebiet als militärisches Übungsgelände gebraucht werde; das ist in dem erwähnten Dokumentarfilm ebenfalls immer wieder zu hören. Mit dieser Begründung werden – wohlgemerkt – Familien vertrieben, die zum Teil seit Jahrhunderten das Land bewirtschaften und ihren Anspruch darauf dokumentieren können; sie haben die nötigen Rechtstitel, um dort zu leben. Aber abgesehen davon, dass die Vertreibungen selbst, wie gesagt, gegen geltendes Völkerrecht verstoßen, muss man auch feststellen, dass die Begründung eine glatte Lüge ist. Auf vielen Fotos, die Rudolf Rogg zeigte, ist deutlich zu sehen, dass auf Hügeln in der Umgebung neue jüdische Siedlungen entstehen. Es handelt sich also eindeutig um ethnische Säuberung: Die ursprünglichen Bewohner des Landes werden vertrieben, um Platz zu machen für jüdische Siedler.
In der Diskussion, die auf den Vortrag folgte, wurde die große Betroffenheit der Zuhörer:innen sehr deutlich. Und mehrfach wurde die Frage gestellt, was man machen kann, um gegen die unhaltbaren Zustände vorzugehen. Leider ist es wohl so, dass sorgfältige Dokumentation und Aufklärung der deutschen Öffentlichkeit nach wie vor die entscheidenden Mittel sind. Eine wirkliche Handhabe zur Änderung der Verhältnisse ist angesichts der Haltung der Politik in Deutschland bedauerlicherweise in absehbarer Zeit kaum zu erwarten.
© Fotos: von der Westbank: Rudolf Rogg
von der Veranstaltung: Klaus Bochem
„Israel weitet Militäreinsatz im Westjordanland aus“
|
Johannes Zang:
Das Massaker des 7. Oktobers 2023 und seine
Vorgeschichte
B u c h v o r s t e l l u n g
|

Zu Recht wies Johannes Zang schon im Titel seines Vortrags darauf hin, dass der zu verurteilende Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 eine Vorgeschichte hat. Das hatte bereits António Guterres betont, als er wenige Wochen nach dem Überfall anmerkte, dieser sei "nicht im luftleeren Raum" entstanden. Der Referent konkretisierte dies, indem er - beginnend mit der ersten Alijah (Einwanderungswelle) - die wesentlichen Etappen erläuterte, die zu einer immer stärkeren Marginalisierung der Palästinenser im eigenen Land führten, im Gazastreifen bis hin zu dem Zustand, der vielfach als "größtes open air-Gefängnis" der Welt bezeichnet wird. Er berichtete von eigenen früheren Besuchen im Gazastreifen und von den vielen Interviews, die er dort geführt hat. Sie alle machen deutlich, dass die Situation dort bereits in den letzten Jahrzehnten immer prekärer wurde. Die Schilderungen verdeutlichten, was die UNO meinte, als sie bereits 2015 davor warnte, dass die Region im Jahre 2020 nicht mehr bewohnbar sein könnte.
Ausgewählte Augenzeugenberichte - oft von ausländischen Ärzten, die dort einige Zeit Dienst tun - über die aktuelle Situation gut ein Jahr nach Beginn des gegenwärtigen Krieges, ergänzt durch Statistiken aus glaubwürdigen Quellen, machten das ganze Grauen der Lage der Palästinenser:innen deutlich, die unter mehrfachen Vertreibungen, Hunger, fehlender medizinischer Versorgung usw. leiden. Auch die Folgen eines Verbots der UNRWA, das Israel für Ende Januar 2025 angekündigt hat, wurden erörtert.
Der Vortrag endete mit "kleinen Zeichen der Hoffnung", die bereits in der Einladung angekündigt waren: Zang stellte einige zivilgesellschaftliche Initiativen vor, die - von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt - arbeiten.
Das ändert allerdings nichts daran, dass die Lage zurzeit verzweifelt ist.
Im anschließenden Gespräch wurde das von den ca. 30 Teilnehmer:innen, von denen sich etliche sehr gut informiert zeigten, deutlich artikuliert - wie auch das völlige Unverständnis dafür, dass die internationale Politik einschließlich der deutschen es nicht schafft, den drohenden Genozid zu beenden.
Foto: © Klaus Bochem
|
Dr. Tamar Amar-Dahl:
Militarismus und Krieg im Heiligen Land
|
Einige ergänzende Angaben zur Referentin:
Dr. Tamar Amar-Dahl studierte Geschichte und Philosophie in Tel Aviv und Hamburg und promovierte an der Ludwig-Maximilian-Universität in München mit einer vielbeachteten Biografie über Israels Altpolitiker: Shimon Peres. Friedenspolitiker und Nationalist (2010).
Weitere Publikationen:
- Das zionistische Israel. Jüdischer Nationalismus und die Geschichte des Nahostkonflikts (2012)
- Zionist Israel and the Question of Palestine. Jewish Statehood and the History of the Middle East Conflict (2017)
- Israel’s Neo-Zionist War Over Palestine: 1993-2021 (2024).
Frau Amar-Dahl schreibt regelmäßig Rezensionen für Sehepunkte, das renommierte Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften.
Das oben genannte Buch "Der Siegeszug des Neozionismus" (Februar 2023) ist für manche einer der wichtigsten Titel, die im Jahr 2023 - deutlich vor dem Überfall der Hamas am 7. Oktober - zum Thema Palästina/Israel erschienen sind. Denn es vermittelt wesentliche Erkenntnisse über gesellschaftliche Entwicklungen in Israel, die zu dem verheerenden, aus unserer Sicht völlig unverhältnismäßigen Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen geführt haben. Damit liefert es einen unverzichtbaren Beitrag zu dem, was der UNO-Generalsekretär António Guterres schon bald nach dem barbarischen Überfall mit dem Wort "Kontext" angesprochen hat und mit der Bemerkung, dass dieser Überfall "nicht im luftleeren Raum" stattgefunden habe. Von der israelischen Regierung wurde er dafür heftig gescholten, der Relativierung und Verharmlosung dieses Überfalls und gar des Antisemitismus bezichtigt. Wer das Buch liest, kann über solche Beschuldigungen nur den Kopf schütteln. Denn dass es einen "Kontext" im Sinne einer vor allem auch ideologischen Vorgeschichte gibt, ist völlig unbestreitbar; und ihn aufzuzeigen, hat nichts mit Verharmlosung und Relativierung zu tun und gar nichts mit Antisemitismus. Es geht vielmehr darum, Zusammenhänge und Mechanismen zu erkennen und zu verstehen, die katastrophale Folgen haben - um sie künftig frühzeitig wahrnehmen und gegensteuern zu können. Dieses "Verstehen" meint also "begreifen" und bedeutet nicht, wie auch deutsche Politikerinnen und Politiker leider immer wieder unterstellen, in einem relativierenden Sinne "Verständnis haben". Es geht um die Beherzigung des bekannten Ausspruchs des spanischen Philosophen George (Jorge) Santayana: "Wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen." Zusammenhänge und Mechanismen genau wahrzunehmen und zu begreifen - und in diesem Sinne zu "verstehen" -, ist folglich eine der wichtigsten Aufgaben der Historikerin und des Historikers.

In der Veranstaltung am 21. September vermittelte die Historikerin Tamar Amar-Dahl in einem anspruchsvollen Vortrag den Zuhörerinnen und Zuhörern tiefe Einblicke in die Politik und Gesellschaft des Staates Israel. Sie gab einen Überblick über die verschiedenen Strömungen und Lager im Land - Säkulare und Religiöse, Nationalreligiöse und Ultra-Orthodoxe, Linkszionisten - Rechtszionisten - Neozionisten usw. Es gebe, so führte sie aus, nicht nur einen Konflikt zwischen Israel auf der einen und Hamas, Hisbollah und dem Iran auf der anderen Seite, sondern auch heftige Konflikte in der israelischen Gesellschaft, die man als eine Art geistig-kulturellen Bürgerkrieg werten könne.
Als eines der grundlegenden Probleme des Staates Israel beschrieb sie die Tatsache, dass die Palästina-/Palästinenser-Frage nicht nur bis heute nicht gelöst wurde ("das grundlegende Legitimationsproblem des Staates Israel"), sondern auch aus dem Bewusstsein der israelischen Gesellschaft völlig verdrängt worden sei: Sie werde in Israel so gut wie nicht diskutiert, habe bei den letzten Wahlen beispielsweise überhaupt keine Rolle gespielt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Vortrags war das Phänomen des sog. "Zivil-Militarismus". Mit diesem Begriff hatte der israelische Soziologe Baruch Kimmerling den Konsens in der israelischen Zivilgesellschaft beschrieben, alle Sicherheitsfragen dem Militär zu überlassen, diesem damit quasi eine Blanko-Vollmacht zu erteilen. Die Folge: Sicherheitsfragen werden nur unter rein militärisch-operativen Gesichtspunkten betrachtet und angegangen, nicht aber unter politischen. Frau Amar-Dahl nannte dies die "Entpolitisierung der Palästinafrage". Eine politische Betrachtung des Problems müsste z.B. nach tieferliegenden Ursachen des Konflikts fragen; die rein militärische fragt nur, wie ein Konflikt mit militärischen Mitteln möglichst effektiv gelöst werden kann. Hier gilt ein unbedingter Primat des Militärs vor der Politik. Hinzu kommt, dass in der Militärdoktrin Israels der Einsatz unverhältnismäßiger Mittel, wie er im Gaszastreifen (und nicht nur in dem aktuellen Krieg) zu beobachten ist, ausdrücklich gefordert wird. Eine der erschreckendsten Erkenntnisse, die das Buch wie auch der Vortrag vermitteln: die Akzeptanz übermäßiger Gewalt als Selbstverständlichkeit.
Die letzten Anmerkungen machen bereits deutlich, dass es in dem Vortrag nicht nur um den Inhalt des vor anderthalb Jahren erschienenen Buches ging, sondern natürlich auch um den gegenwärtigen Gaza-Krieg. Hierzu konnte Frau Amar-Dahl einige Informationen geben, die dem deutschen Blick in der Regel verborgen bleiben, z.B. bezüglich der heftigen Auseinandersetzungen zwischen Premier Netanjahu und den führenden Militärs. Der beschriebene "Zivil-Militarismus" wiederum wird gegenwärtig deutlich in der Tatsache, dass die israelische Zivilgesellschaft zwar die Handhabung der Geiselfrage heftig kritisiert, aber den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt im Gazastreifen und neuerdings auch im Libanon mit großer Mehrheit unterstützt.

Die anschließende Diskussion machte deutlich, dass bei aller Verwirrung über die aus deutscher Sicht unübersichtlichen Strömungen und Fraktionen in der israelischen Gesellschaft das Interesse an den Hintergründen der ständigen Spannungen und Konflikte sowie an der Frage, wie sie überwunden werden könnten, bei uns nach wie vor sehr groß ist.
Video-Aufzeichnung: https://www.youtube.com/watch?v=5BSe2oIJCxw
Fotos: © Klaus Bochem
|
Die Lage in der Westbank vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges
Vortrag und Diskussion
mit der Reiseführerin Hiam Abu-Dahhyeh aus Beit Jala
|

Der Arbeitskreis führte zunächst kurz in die politisch-geografischen Gegebenheiten ein: Verlauf der „Sperranlage“, die die Westbank abschottet, deren Einteilung in drei Zonen und Lage der wichtigsten Orte (s.u.).
Frau Abu-Dayyeh nutzte anschließend die Gelegenheit, die Geschichte Palästinas seit dem Ende des 19. Jhs. darzustellen, also seit der ersten zionistischen Einwanderungswelle („Alija“). Gestützt auf Bevölkerungsstatistiken und viele historische Fotos zeigte sie, wie die Palästinenser:innen in ihrem eigenen Land durch die Zuwanderer unter Druck gerieten. Über den israelischen Unabhängigkeitskrieg und die damit verbundene Vertreibung von über 700.000 Palästinenser:innen („Nakba“) im Jahre 1948 zog sie die Linie bis zur gegenwärtigen Situation: den Zerstörungen und Vertreibungen im Gaza-Krieg, der mit dem Überfall der Hamas auf die israelische Grenzregion am Gazastreifen am 7. Oktober 2023 begann, sowie den Auswirkungen dieses Krieges auf das Westjordanland.
Sie schilderte das immer aggressivere Auftreten der zionistischen Siedler:innen dort und ihre Unterstützung durch das Militär. Die Siedler:innen bedrohen die palästinensischen Landwirte, die bei der Olivenernte ebenso behindert werden wie insgesamt bei der Bestellung ihrer Felder. Hinzu kommen zunehmend Einschränkungen der Bewegungsfreiheit für die Palästinenser:innen durch mobile Checkpoints, aber mehr noch durch das Absperren von Straßen durch Erde und Schutt, die auf den Straßen aufgehäuft werden. Kraftfahrern, die trotz aller Einschränkungen in der ganzen Westbank beruflich unterwegs sein müssen, wird dadurch nicht nur ihre Arbeit enorm erschwert; vielmehr leben sie und ihre Angehörigen aufgrund der aggressiven Stimmung im Land in ständiger Angst um ihr Leben und eine sichere Heimkehr.

Den 35 Teilnehmer:innen wurde durch den Vortrag anschaulich vor Augen geführt, wie sehr das ohnehin seit Jahrzehnten durch die israelische Besatzung stark eingeschränkte Leben in der Westbank durch die Auswirkungen des Gazakrieges noch einmal deutlich erschwert wird. Deutlich spürbar war die persönliche Betroffenheit der Referentin, die in Beit Jala lebt.
Fotos: © Klaus Bochem
Karte von 06/2013
|
Combatants for Peace
Vortrag und Diskussion mit einem jüdischen und einem palästinensischen Mitglied dieser Friedensinitiative
|
Der Israeli Rotem Levin, aufgewachsen in einem kleinen Dorf mitten im „Kernland“ Israel, und der Palästinenser Osama Eliwat aus Jericho erzählten an diesem Abend davon, wie sie aufgewachsen und wie sie zu der Gruppe Combatants for Peace gekommen sind. Und natürlich war auch die aktuelle Lage ein Thema: der Gaza-Krieg, der mit dem brutalen Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf ein Festival in Israel und mehrere Kibbuzim begonnen hat und zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch andauerte.
Von links nach rechts: Thomas Trischler, Osama Eliwat, Rotem Lewin
Die Erzählungen aus ihrer Kindheit und Jugend machten eines sehr deutlich: Dass beide Seiten, Israelis wie Palästinenser, mit einem sehr einseitigen Bild von den jeweils anderen aufgewachsen sind, einem Bild, das in dem anderen oft nur den Feind sehen lässt:
- Osama Eliwat lernte als Schulkind von ca. 12 Jahren die Israelis kennen als schwerbewaffnete Soldaten, die über das alltägliche Leben in dem palästinensischen Ort bestimmen konnten und die ihm Angst einjagten. Das prägte sein Bild von „den Juden“; sie waren für ihn dominant, aggressiv, feindselig. Als junger Mann kam er durch einen Freund in Kontakt mit einer Gruppe in Bethlehem, in der Juden und muslimische Palästinenser gemeinsam für die Überwindung der Feindseligkeiten eintraten. Erst diese persönliche Begegnung öffnete ihm die Augen dafür, dass es auch „andere“ Juden gibt als die, der er als Kind kennengelernt hatte. Juden, mit denen man reden kann, die dieselben Bedürfnisse und Interessen haben – vor allem die Sehnsucht nach einem Leben in Frieden.
- Rotem Levin lernte Palästinenser als Angestellte im Haus seiner Eltern kennen, das in einem rein jüdischen Ort lag. Diese Angestellten kamen aus einem benachbarten Dorf, in dem wiederum nur Palästinenser lebten. Getrennte Welten also; die Beziehung war eine rein geschäftliche und mit dem Verhältnis von Arbeitgebern und Angestellten auch eine deutlich hierarchische.
Auch in der Schule lernte er nichts über die Geschichte und die Kultur der Palästinenser, die immerhin seine Nachbarn waren. Das Erlernen des Arabischen wurde nicht angeboten. Im Nachhinein ist sich Rotem sicher, dass dies von der Regierung und der Schulbehörde so gewollt war: Man sollte nichts über die einheimische palästinensische Bevölkerung wissen; möglicherweise hätte man ja sonst das allgemein Menschliche an ihnen erkannt…
Das bestätigt auf der Ebene der persönlichen Erfahrung eine Studie über Palästina in israelischen Schulbüchern: Ideologie und Propaganda in der Erziehung, die die jüdisch-israelische Hochschullehrerin Nurit Peled-Elhanan 2012 veröffentlicht hat. In diesen Büchern, so zeigt sie, werden die Palästinenser als aggressive, unterentwickelte, primitive Kameltreiber dargestellt.
Im Laufe der Zeit erkannte Rotem, dass etwas an diesem Bild nicht stimmte. Nach seinem Militärdienst lernte er Arabisch und gewann viele palästinensische Freunde.
Gemeinsam bemühen sich Osama und Rotem seit vielen Jahren, ihre Einsichten vor allem an Jugendliche weiterzugeben. Besonders die Erkenntnisse,
Ø dass sie ihr einseitiges und falsches Bild des anderen überwinden müssen und
Ø dass nur ein gewaltfreies Miteinander den seit Jahrzehnten immer wieder blutig ausgetragenen Konflikt zwischen Juden und Palästinensern überwinden kann.
Allerdings ist Combatants for Peace nur eine kleine Organisation. Sie zählt ca. 100 Mitglieder und hat etwa 500 Unterstützer. Zur jährlichen Joint Memorial Ceremony, die – gemeinsam mit dem Parents Circle Families Forum – immer am Vorabend des Israeli Memorial Day veranstaltet wird, kommen jedoch immerhin bis zu 12.000 Teilnehmer.
Diese Veranstaltungen sind oft begleitet von wütenden Protesten rechtsgerichteter Zionisten, die am Eingang zu der Veranstaltungshalle stehen und die ankommenden Teilnehmer als Verräter beschimpfen.
- Angaben auf Wikipedia:
Die Bewegung entstand als Reaktion auf die Zweite Intifada (2000–2005) […]. Sie hatte 70 Mitglieder im ersten Jahr und zählte nach zwei Jahren 200 Personen. Nach Angaben von Sulaiman Khatib haben sich 2020 während der Versammlungsbeschränkungen wegen Covid-19 rund 200.000 Personen zu einer Veranstaltung weltweit online zugeschaltet. Die Bewegung arbeitet mit der ähnlich ausgerichteten Gruppe The Parents Circle Families Forum zusammen. Gemeinsam mobilisierten sie am 24. April 2023 am Vorabend zu Jom haZikaron [dem israelischen Memorial Day] rund 15.000 Personen in Tel Aviv. Unter den Teilnehmern befanden sich auch 150 Palästinenser.
- Zu den Combatants for Peace siehe https://cfpeace.org/
- Zum Parents Circle: https://www.theparentscircle.org/en/pcff-home-page-en/
- Die Arbeit der Combatants for Peace, die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben bis hin zu den Anfeindungen durch rechtsgerichtete Zionisten bei der Joint Memorial Ceremony schildert die israelische Autorin Lizzie Doron sehr eindrucksvoll in ihrem Roman Sweet Occupation, der auf dieser Homepage ausführlich besprochen ist. Siehe hier.
Den aktuellen Gaza-Krieg ordneten die Gäste ein in die Reihe der Gaza-Kriege, die seit 2008 immer wieder ausbrechen. Für die beiden ist klar: Die Feindseligkeiten werden erst aufhören, wenn die Besatzung des Westjordanlandes und die Abriegelung des Gazastreifens beendet werden und die Palästinenser dieselben Rechte zugestanden bekommen wie die Juden.
Osama fasste es mit den Worten zusammen:
„Die Juden werden erst sicher sein, wenn die Palästinenser frei sind;
und die Palästinenser werden erst frei sein, wenn die Juden sicher sind.“

Die Zahl von ca. 100 Teilnehmern an unserer Veranstaltung und die vielen, z.T. sehr differenzierten Fragen und Beiträge in der Diskussion, die sich an den Vortrag anschloss, zeugten von einem erfreulich breiten Interesse an dem Thema.
Thomas Trischler vom Zivilen Friedensdienst (ZFD), in dem neun deutsche Friedens- und Entwicklungsorganisationen zusammenarbeiten und der von der Bundesregierung gefördert wird, begleitete die beiden Vertreter der Combatants und übersetzte deren Ausführungen aus dem Englischen. Dr. Michael van Lay-Exeler (Bild links), Mitglied des AK Palästina Brühl-Battir, moderierte den Abend.
Anmerkung: Die kleiner geschriebenen und eingerückten Passagen sind Ergänzungen des Arbeitskreises.
Fotos: © Klaus Bochem
|
Andreas Altmann:
Verdammtes Land. Eine Reise durch Palästina
Lesung des Autors aus seinem gleichnamigen Buch und Diskussion
|
Rückseite des Einbandes:
Datum: Freitag, 18. November 2022
Ort: Rathaus der Stadt Brühl, Uhlstraße 3, Kapitelsaal
Zeit: 19.30 Uhr
Eintritt: 14 € im Vorverkauf, 17 € an der Abendkasse
Vorverkauf durch die Buchhandlung Brockmann,
Uhlstraße 82, 50321 Brühl Tel.: 02232 410498

Als Reiseschriftsteller ist Andreas Altmann bekannt für seine wachen und kritischen Beobachtungen und für seine erfrischend unverblümte Sprache. Beides entfaltete auch an diesem Abend seine Wirkung.
Inhaltlich präsentierte Herr Altmann eine Mischung von sehr persönlichen und anrührenden Begegnungen in dem besetzten Land sowie scharfen Beobachtungen oft bedrückender Szenen; etwa von Hauszerstörungen, die regelmäßig als - völkerrechtlich verbotene - Kollektivstrafe ausgeführt werden, wenn ein einziger Bewohner des Terrorismus verdächtigt wird.

Die Sprache mal einfühlsam, mal schonungslos; eine Sprache, die Missstände, ja Verbrechen klar als solche benennt.
Das eindeutige Engagement für Menschlichkeit und Menschenrechte und gegen Unterdrückung und Machtmissbrauch wurde unterstrichen durch den teils emphatischen Vortrag des Autors.
Bürgermeister Dieter Freytag, bekannt für seine Verbundenheit mit Palästina im Allgemeinen und unserer Partnerstadt Battir im Besonderen, begrüßte den Referenten. Dabei hob er die Bedeutung des Engagements für eine Region hervor, deren Bewohnerinnen und Bewohner in äußerst prekären politischen Verhältnissen leben.
Fotos: © Klaus Bochem
|
Kerstin Winge: Oneway. Berlin - Gaza. Als Deutsche im Gazastreifen. Tagebuch
B u c h v o r s t e l l u n g
|
Termin: 5. März 2022
Ort: Begegnungszentrum margaretaS,
Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Zeit: 16.00 Uhr
1994 reiste die Autorin zusammen mit ihren beiden kleinen Söhnen ihrem palästinensischen Ehemann in dessen Heimat hinterher: in den Gazastreifen. Das Leben dort bis zu ihrer endgültigen Rückkehr nach Berlin im Jahre 2008 bildet den wesentlichen Inhalt des Buches, das Kerstin Winge vorstellen wird. Auf der Rückreise hat sie nur ihren jüngsten Sohn dabei, der im Gazastreifen geboren wurde.
Der Sprengstoff, der schon in diesen drei Sätzen liegt, entfaltet in dem Tagebuch seine volle Wirkung. Kerstin Winge trifft auf eine Kultur, die sich in vielem von dem unterscheidet, was sie von zu Hause kennt. Das gilt vor allem für die Familien- und Nachbarschaftsbande, die viel dichter und enger sind, als sie es aus Deutschland gewohnt ist – enger und oft auch beengend. Und auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist ein deutlich anderes.
Ende 2000 bricht dann die zweite „Intifada“ aus, der zweite Aufstand der Palästinenser gegen die israelische Besatzung. Schon wenn man Filme darüber im Fernsehen sieht, ist man entsetzt. Kerstin Winge aber hat es hautnah miterlebt. Denn das Haus, das ihr Mann am Stadtrand von Chan Yunis im Süden des Gazastreifens gebaut hat, liegt in unmittelbarer Nähe einer israelischen Siedlung. Dass gleichzeitig die Hamas im Gazastreifen die Herrschaft übernimmt, macht die Situation nicht eben leichter.
Verschiedene Faktoren führen dazu, dass es irgendwann einfach nicht mehr geht; dass Frau Winge keinen anderen Weg mehr sieht, als nach Berlin zurückzukehren – für immer.
Kerstin Winge schildert das alles in ihrem Tagebuch ungeschönt.
Es ist ein aufwühlendes und packendes Buch.

Etwa 20 Zuhörerinnen und Zuhörer folgten dem Vortrag, in dem Kerstin Winge es verstand, die Darstellung sehr persönlicher Erlebnisse und die der gesellschaftlichen Situation sowie des politischen Hintergrundes miteinander zu verbinden. So bekamen die Anwesenden die seltene Gelegenheit, einen authentischen Einblick in das Leben im Gazastreifen zu erhalten und damit in eine Region, die durch die Medien geht, wenn mal wieder die Raketen fliegen, die aber - im Unterschied zur Westbank - in der Berichterstattung noch mehr als diese eine untergeordnete Rolle spielt. Das spiegelt auf medialer Ebene quasi die Tatsache wider, dass der Gazastreifen im wahrsten Sinne abgeschlossen ist - ein open-air-Gefängnis. Für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die dort wohnen, ist es beinahe unmöglich, dieses Gefängnis zu verlassen; und selbst für die Deutsche Kerstin Winge war die Organisation eines Besuchs in ihrer Heimat Berlin mit großen bürokratischen Hindernissen verbunden.
Probleme bei der Ausreise sind nur eine Folge des israelischen Besatzungsregimes, das auch nach der Räumung der israelischen Siedlungen 2005 das Leben der Menschen im Gazastreifen bestimmt. Probleme bei der Einfuhr von Lebensmitteln und anderen Mitteln des täglichen Bedarfs bis hin zur Behinderung der Einfuhr von Baumaterialien, die den Wohnungsbau für eine ständig wachsende Bevölkerung erschwert, kommen hinzu; und nicht zuletzt die ständige Bedrohung durch die martialisch auftretenden Soldaten nicht nur an den Checkpoints. Die Referentin selbst hat die Bedrohung mehrfach am eigenen Leib zu spüren bekommen, etwa bei nächtlichen Razzien in ihrem Haus durch israelische Soldaten nach dem Ausbruch der zweiten Intifada, aber auch durch die Hamas, die 2006 die Herrschaft übernahm.
Abgerundet wurde die Darstellung durch die Schilderung privater Ereignisse; dazu gehörten Hochzeitsfeiern, die Einweihungsfeier ihres Hauses und Szenen aus dem Alltagsleben der Familie.
All dies veranschaulichte die Referentin durch viele persönliche Fotos, bei deren Präsentation ihr Ehemann René sie unterstützte.

Es war insgesamt eine sehr facettenreiche Veranstaltung: Nicht nur die beiden Ebenen des Politischen und des Privaten trugen zu der Vielschichtigkeit bei, sondern auch Licht und Schatten auf jeder dieser Ebenen: Für Kerstin Winge gab es ein happy end, eindrucksvoll vor Augen geführt durch das letzte Bild des Vortrags, das sie im Kreis ihrer drei Söhne zeigt - nach dem schwierigen Leben im Gazastreifen glücklich vereint in Deutschland. Aber auch die bedrückende Lage, in der die Palästinenserinnen und Palästinenser leben und die sich seit der Rückkehr der Referentin nach Deutschland im Jahr 2008 eher noch verschlechtert hat, zog sich als düsterer Unterton durch den Bericht.

Im Anschluss an den Vortrag beantwortete Kerstin Winge noch mehr als eine halbe Stunde lang zahlreiche Fragen aus dem Publikum, die von einem lebhaften Interesse sowohl an der politischen Situation als auch an den persönlichen Erfahrungen der Referentin zeugten.
Die Veranstaltung wurde wiederum unterstützt von der Buchhandlung Brockmann, aber auch vom Institut für Palästinakunde in Bonn, deren Leiterin Angelika Vetter den Kontakt zu Frau Winge vermittelt hatte und zusammen mit ihrem Mitarbeiter Thomas Siemon das Ehepaar Winge nach Brühl begleitete.
Fotos: © Klaus Bochem
|
Johannes Zang: Erlebnisse im Heiligen
Land
B u c h v o r s t e l l u n g
|

Johannes Zang las einige Kapitel aus seinem neuen Buch. Er traf dabei eine geschickte Auswahl, die einen überzeugenden Einblick in die ganze Bandbreite der Thematik und zugleich einen guten Eindruck von der Vielseitigkeit des Buches vermittelte. So wurden etwa die verschiedenen Religionen vorgestellt, auch in ihren teilweise sehr befremdlich anmutenden Aspekten wie den Streitigkeiten zwischen den diversen christlichen Denominationen in der Grabeskirche in Jerusalem; es gab Heiteres - z.B. eine Auswahl palästinensischer Witze - und Beklemmendes, z.B. die eindrucksvolle Schilderung einer Autofahrt über eine Strecke von 110 Kilometern, die infolge der vielen Checkpoints und der durch sie verursachten Wartezeiten sowie durch die - meist vergebliche - Suche nach Umwegen mehr als neun Stunden (!) dauerte.

Aufgrund dieser Auswahl verschiedenster Themen war der Vortrag sehr abwechslungsreich und trotz mancher bedrückender Aspekte sogar kurzweilig. Dazu trugen auch die vielen eigenen Fotos bei, mit denen der Referent seine Präsentation veranschaulichte.
Sowohl hier als auch im anschließenden Gespräch konnte Johannes Zang aus der Fülle seiner Erfahrungen schöpfen, die er in einigen mehrjährigen Aufenthalten sowie in vielen Reisen als Reiseleiter sammeln konnte, und aus vielen Begegnungen sowohl mit einfachen Menschen als auch mit herausragenden und beeindruckenden Persönlichkeiten. Darüber hinaus zeugten seine Ausführungen von einer gründlichen Kenntnis der Fachliteratur über das Heilige Land in seinen vielfältigen Facetten. Die glückliche Verbindung eines großen Erfahrungsschatzes mit profundem Fachwissen prägt auch das Buch selbst: Es ist sehr fundiert, zugleich authentisch und in der Darstellung sehr lebendig.

Wegen der erfreulich großen Zahl von 58 Besucherinnen und Besuchern musste die Veranstaltung kurzfristig in die Kirche St. Margareta verlegt werden, da in dem ursprünglich vorgesehenen Begegnungszentrum coronabedingt nur 40 Personen zugelassen waren. Offensichtlich sehnen sich die Menschen wieder nach kulturellen Veranstaltungen, aber es war auch erkennbar das Thema selbst, das auf großes Interesse stieß: Viele der Besucherinnen und Besucher hatten sich, wie in dem Gespräch deutlich wurde, schon mit ihm befasst und viele hatten Israel und Palästina auch schon besucht.
An einem Büchertisch, den die Buchhandlung Brockmann aufgebaut hatte, konnten die Besucherinnen und Besucher gleich anschließend das Buch wie auch frühere Bücher des Referenten erwerben.
Von dieser Möglichkeit wurde reger Gebrauch gemacht.
Es war ein rundum gelungener Abend.
© Fotos: Klaus Bochem
|
Holy Land Trust
Vorstellung einer Friedensinitiative aus Bethlehem
|
Das Unmögliche möglich machen - Frieden im Heiligen Land
Der Holy Land Trust (HLT) ist eine lokale Nichtregierungsorganisation in Bethlehem in den palästinensischen Autonomiegebieten. Sie
strebt einen stabilen und gerechten Frieden zwischen Israelis und Palästinensern an und arbeitet seit 1988 aktiv mit drei Zielgruppen zusammen: Palästinenser*innen, Israelis und der internationalen Gemeinschaft.

Wie Elias Dies, der Geschäftsführer des HLT, erläuterte, besteht eine der Maßnahmen darin, dass regelmäßig junge Israelis zu gemeinsamen Aktionen in das Westjordanland eingeladen werden, beispielsweise zur Olivenernte, aber auch zum Wiederaufbau von Häusern, die das israelische Besatzungsregime hat abreißen lassen.
Dem liegt folgendes Problem zugrunde:
Während die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland sich ständig ausdehnen, wird Palästinensern nur selten eine Baugenehmigung erteilt - und das seit Jahrzehnten. Da die Familien aber wachsen, muss Wohnraum geschaffen werden; und da die Baugenehmigung nicht erteilt wird, wird aus der Notlage heraus oft ohne diese gebaut - für die Besatzungsmacht ein Grund, die Häuser abzureißen.
(Laut dem UN-Büro für die Koordination humanitärer Belange in den besetzten palästinensischen Gebieten - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory, kurz OCHA - wurden im ersten Quartal des Jahres 2021 insgesamt 292 Einrichtungen zerstört - gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres eine Zunahme von mehr als 120 %. Siehe https://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_monthly_report-mar_2021.pdf)
Bei ihrem Einsatz erleben die israelischen Jugendlichen also selbst, was es bedeutet, unter Besatzung zu leben. Die Hoffnung von HLT ist, dass sie davon zu Hause erzählen, um die israelische Gesellschaft, die darüber wenig informiert ist, überhaupt auf die Problematik aufmerksam zu machen.
Zu den Programmen von HLT zählen außerdem Emanzipationsprojekte zur Stärkung von jungen palästinensischen Frauen und Mädchen, Kurse in gewaltfreier Kommunikation und Dialogprojekte zwischen Israelis und Palästinenser*innen.
Ziel ist es insgesamt, die Zivilbevölkerung im Heiligen Land zu stärken, um eine bessere Zukunft für alle BewohnerInnen und Bewohner zu erreichen.
Die Veranstaltung fand am 23. September 2021 im
Begegnungszentrum margaretaS in Brühl statt.
Das Bild zeigt Elias Dies - rechts - neben seinem Übersetzer Thomas Trischler.
© Foto: Klaus Bochem